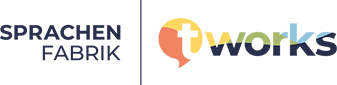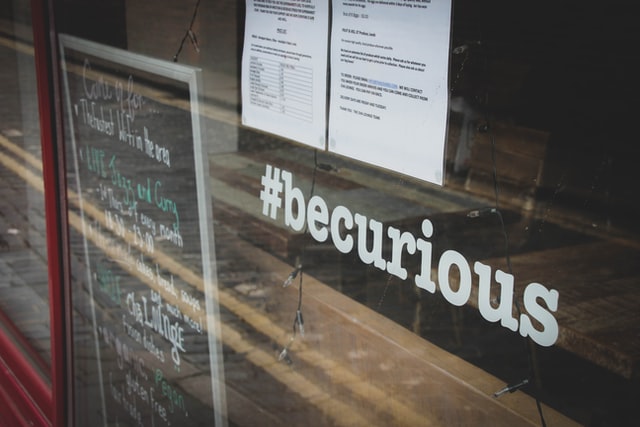Herbst in Asien: ein Kaleidoskop der Kulturen
Die Tage werden kürzer, das Laub verändert seine Farbe, kurzum: Es ist Herbst. Um „Licht ins Dunkel zu bringen“, begehen wir in westlichen Kulturkreisen Feste wie Erntedank, Halloween, Allerheiligen oder den Reformationstag. Doch wie feiert man in anderen Teilen der Welt den Herbst? Unsere Praktikantin Justine nimmt uns mit auf eine Reise durch die herbstlichen Bräuche Asiens.
Das Mittherbstfest in China
In vielen Teilen Asiens gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Feier des Erntedankfestes und dem Erscheinen des Mondes. In China wird dies am 15. Tag des 8. Monats des chinesischen Mondkalenders mit dem Mondfest, auch als Mittherbstfest bekannt, zelebriert. Bei den Feierlichkeiten versammeln sich Menschen in geselliger Runde, um den Vollmond zu bewundern und als Symbol für diesen runde Gebäcke auszutauschen. Die sogenannten Mondkuchen sind mit verschiedenen Zutaten wie Hackfleisch, süßer Bohnenpaste oder salzigem Eigelb gefüllt. Ein weiterer herbstlicher Brauch ist nicht nur in China sehr beliebt bei Kindern: Laternen basteln. Bei uns hauptsächlich zu Sankt Martin üblich, sind Laternenumzüge und Ausstellungen in China fester Bestandteil der wichtigsten Feste. Somit können auch beim Mittherbstfest die schönen, bunten Lampions in Parks und an anderen öffentlichen Plätzen bewundert werden.
Chuseok – ein koreanisches Fest der Ahnen und des herbstlichen Segens
Gleichzeitig feiert Korea Chuseok, was so viel wie „Herbstabend“ bedeutet. Zu diesem Anlass reisen viele Koreaner*innen zurück in ihre Heimat, um ihre Dankbarkeit für die Herbsternte auszudrücken und ihre Vorfahr*innen zu ehren. Besonders beliebt bei diesen Feierlichkeiten ist Songpyeon, ein halbmondförmiger Reiskuchen, der mit Sesam oder Kastanien gefüllt und über Kiefernnadeln gedämpft wird. Das verleiht ihm ein besonderes Aroma. Es heißt, besonders schön geformte Songpyeon bringen Glück in der Ehe und versprechen gesunde Nachkommen. Ein weiterer Brauch während Chuseok ist der Beolcho. Dabei besuchen Familien, ähnlich wie bei uns an Allerheiligen, die Gräber ihrer Verwandten und entfernen Unkraut – ein Zeichen von Hingabe und Respekt.
Würdigung des Herbsts durch die japanische Sprache
Japan hat in der Sprache eigene Begriffe, um die Schönheit von herbstlichen Waldlandschaften zu beschreiben: Momiji und Kōyō. Kōyō steht für den natürlichen Prozess, durch den sich die Blätter im Herbst von Grün zu Rot verwandeln, Momiji bezieht sich hingegen speziell auf die rot gefärbten Ahornblätter des Herbstes. Momiji Manju aus der Präfektur Hiroshima, einem südwestlichen Teil Japans, ist die Bezeichnung einer traditionellen Speise: eine beliebte Sorte von Reiskuchen, die mit roter Bohnenpaste gefüllt und so geformt werden, dass sie den bunten Ahornblättern ähneln.
Diwali – ein Fest der Lichter und Farben
In Indien erleuchtet Diwali, das Fest der Lichter, die Herbstnächte. Immer am 15. Tag des Monats Kartik im hinduistischen Kalender – meist zwischen Ende Oktober und Anfang November – verwandelt sich Indien in ein funkelndes Lichtermeer: Häuser werden mit Kerzen, Lichtern und Tonlampen geschmückt, Feuerwerke gezündet und Süßigkeiten wie zum Beispiel Laddus geteilt. Ein wichtiger Teil von Diwali ist die Reinigung des Hauses, um die Göttin Lakshmi willkommen zu heißen. Die Menschen glauben, dass sie nur in ein sauberes und ordentliches Haus kommt, um Reichtum und Glück zu bringen. Deshalb wird während des 5-tägigen Fests alles gründlich geputzt, entrümpelt und manchmal sogar neu gestrichen.
Ein weiterer faszinierender Aspekt von Diwali ist die Kunst des Rangoli. Mit Reismehl, Sand oder farbenfrohen Blütenblättern werden am Boden kunstvolle Muster gestaltet, die den Mond und die Götter repräsentieren. Obwohl Diwali in den unterschiedlichen Regionen Indiens verschiedene mythologische Bezüge hat – sei es die Rückkehr von Gott Rama in Nordindien, der Sieg Krishnas über einen bösen Dämon im Süden oder die Verehrung der Göttin Kali in Bengalen – symbolisiert das Fest in seiner Essenz stets Freude, Dankbarkeit und die triumphale Überwindung der Dunkelheit durch das Licht.
Jede Kultur feiert den Herbst auf ihre einzigartige Art und Weise, doch inmitten dieser Vielfalt zeigen sich auch Gemeinsamkeiten: das Beisammensein, Staunen, Feiern und die Liebe zur Natur.